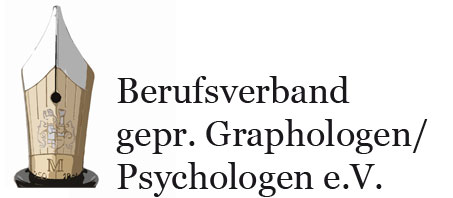Der elastische Strich – Eine Graphologin erzählt
OSTFILDERN. Schrift sei Körpersprache auf feinmotorischer Ebene, sagt Christa Hagenmeyer. Personalchefs von Unternehmen vertrauen dem Rat der Graphologin, vor allem wenn es um die Einstellung von Führungskräften geht.
Es gibt Handschriften, die findet Christa Hagenmeyer wenig prickelnd. Bei anderen kommt sie geradezu ins Schwärmen. Wie bei der von Papst Johannes Paul II.: „eine fast zierliche, hoch durchgeistigte Schrift, sie vibriert regelrecht vor Rhythmus.“ Es gebe Machertypen, die breiteten sich förmlich auf dem ganzen Papier aus. Beim Papst sei das anders. „Der hatte das nicht nötig.“
Christa Hagenmeyer ist eine sorgfältige Frau. Der Parkettboden in ihrem Arbeitszimmer ist nach Jahren immer noch kratzerfrei. Jedes kleine Ding scheint seinen angestammten Platz zu haben, die geschnitzte Heiligenfigur neben dem alten Cembalo. Grafologie sei keine rein intellektuelle, ordnende Angelegenheit, sagt sie. „Man muss sehen lernen.“
Mit Schriften hatte sie immer zu tun. An der Universität Heidelberg beschäftigte sich die promovierte Philologin mit Handschriften mittelalterlicher Fachliteratur. Fast ehrfürchtig erzählt sie von dem Codes Manesse, einer 700 Jahre alten Sammlung mittelhochdeutscher Lyrik, den sie schon in Händen halten durfte. Später als Lehrerin gehörten die Handschriften von Gymnasiasten in Ostfildern, wo sie Deutsch, Geschichte, Ethik und Psychologie unterrichtet hat, zu ihrem Metier. „Der Umgang mit Handschriften war mein täglich Brot“, sagt sie. Da lag die Graphologie nahe. Ein Handwerk, das manche mit Skepsis sehen.
Seit ihrer Pensionierung betreibt die 66-Jährige eine graphologische Praxis in Ostfildern. Sie ist im Vorstand des Berufsverbandes geprüfter Graphologen, der Deutschen Graphologischen Vereinigung sowie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Europäischen Gesellschaft für Schriftpsychologie.
Die meisten ihrer Kunden findet man in der Personalabteilung von Firmen. Unternehmen vertrauen bei der Besetzung von neuen Stellen, vom Lehrling bis zum Betriebsleiter, auf ihren fachmännischen Rat. Sie arbeite gern für mittelständische Betriebe, die noch von den Inhabern geführt werden, sagt sie. Da sei das Interesse an den künftigen Mitarbeitern am größten. Aber auch Konzerne mit mehreren tausend Beschäftigten lassen sich von ihr beraten, vor allem bei der Einstellung von Führungskräften. Dass sie dabei die Bewerber nicht persönlich kennen lernt, sieht sie nicht als Nachteil. „Viele verstehen es, durch zahlreiche Kurse geschult, sich glänzend darzustellen.“ Bei einer Schriftprobe hingegen gebe es kaum Möglichkeiten, sich zum eigenen Vorteil zu verstellen. Ein Täuschungsversuch ist rasch entlarvt. „Viele strengen sich an, besonders schön zu schreiben, das Ergebnis ist ein verzerrtes, unstimmiges Bild.“ Die Spontanschrift sei da am ehrlichsten. Manchmal kämen Paare, die wissen wollten, ob sie zusammenpassen. Das Schriftbild als Indikator für Eheharmonie. Letztlich könnten ihre Gutachten nur ein Mosaikstein und vielleicht das ausschlaggebende Quäntchen für Entscheidungen sein, sagt Hagenmeyer. „Meine Empfehlungen runden das ganze Bild ab.“
Wie beim Vorstellungsgespräch zählt auch bei der Graphologie zunächst der erste Eindruck, die „Anmutung“, wie sie sagt. Sie schaut sich das beschriebene Blatt Papier einige Zeit an, lässt „das Schriftbild in seiner Komplexität“ auf sich wirken und legt es wieder weg. Nach mehreren Stunden nimmt sie es nochmals zur Hand, sucht dann nach beherrschenden Merkmalen, die eigentliche Analyse beginnt. Das kann eine extrem nach rechts geneigte Schrift sein – „der Reiter auf dem Pferd, der die Welt erobert“. Das können auch abfallende Zeilen sein, „Menschen mit Durchsetzungsvermögen halten eher die Linie.“ Das können sehr tiefe Unterlängen etwa bei p oder g sein, die eine „starke Ausprägung des Triebhaften“ wahrscheinlich machten.
Wer Chef sein will, sollte zügig schreiben und damit Willenskraft erkennen lassen. „Aber wenn einer nur aus Willen besteht, ist es auch nichts.“ Ein angehender Außendienstler zeigt seine Flexibilität und Kontaktfreudigkeit durch einen elastischen Strich und geschickter Verknüpfung der Buchstaben. Jedes Einzelmerkmal zählt. Wie schwingt jemand ein Wort aus: reicht er im übertragenen Sinn seinem Gegenüber noch die Hand oder bricht er abrupt ab – basta. Kann er Nähe zulassen oder ist das Blatt von Lücken zwischen Buchstaben, Wörtern und Zeilen durchzogen, „Sandbänke“ wie der Graphologe sagt. Schreibt er ein Blatt randlos zu, oder kann er sich und bestenfalls auch anderen Raum lassen. Schreibt er sorgfältig oder kaum lesbar, ist er ein verspielter Typ und reichert seine Wörter mit Schnörkeln an, schreibt er groß oder klein, rund oder zackig? Wie viel Druck verwendet er? „Eine Schrift ist ein Relief“, sagt Christa Hagenmeyer. Für ein Gutachten benötigt sie deshalb immer die Originale – keine Kopien und auch kein Fax.
Schließlich werden alle Merkmale „abgewogen, miteinander in Diskussion gebracht und mit dem Stellenprofil abgeglichen.“ In eine Gesamtbetrachtung fließe auch ein, ob jemand etwa für die Schriftprobe einen Wirtschaftstext oder eine Stelle aus dem Alten Testament abschreibt, welches Papier er verwendet – „manche nehmen Bütten, das wirkt nicht angemessen“ – oder auch womit er schreibe. „Je höher die Position, desto selbstverständlicher ist der Füller.“
Die ersten Beobachtungen zur Handschrift sind aus der Antike überliefert. So äußerte sich bereits der römische Schriftsteller Sueton über die Schrift Caesars. Das 16. Jahrhundert gilt als Beginn der individuellen Schriftentwicklung, Paradebeispiel ist die markante Handschrift Martin Luthers. Begründer der heutigen Graphologie ist der französische Abbé Michon mit seinem 1875 verfassten „Système de la Graphologie“. Auch in Deutschland habe sich seit der Jahrhundertwende eine große graphologische Tradition entwickelt, sie sei von den Nazis zerstört worden und durch die Amerikanisierung auch nach dem Zweiten Weltkrieg schwach geblieben, sagt Christa Hagenmeyer, „in den USA hat die Graphologie keinen Platz.“ Anders in Frankreich, Italien und Belgien, wo heute 80 Prozent der Firmen Graphologen beauftragen. In Deutschland gebe es dagegen kaum Kollegen, die allein von diesem Beruf leben könnten.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Graphologie auch zunehmend mit der Tiefen- und Entwicklungspsychologie verknüpft. Christa Hagenmeyer zeigt das Blatt eines Professors, dessen Schrift fast wie die eines Kindes anmutet. „Er hat sich nie von der Schulvorlage frei machen können, ein Zeichen für wenig Reife.“ Auch Zeitgeist und Wertewandel kämen in der Handschrift zum Ausdruck. Die strenge Hierarchie früherer Gesellschaften fände ihr Pendant in fast sklavisch-regeltreuen Schriftbildern, heute gebe es individuellere Schriften. Christa Hagenmeyer holt eine Schriftprobe des Industriellen Hugo Stinnes (1870-1924) aus einem Ordner. Es lässt selbst Laien einen dirigistischen, rigiden Führungsstil erahnen. Heutige Managerschriften seien weicher, lebendiger, sagt sie.
Sie verlangt von potenziellen Managern neben der Handschriftenprobe auch eine Unterschrift. Oft gebe es Unterschiede zwischen beiden. So begutachtete sie jüngst einen Bewerber, dessen Schriftbild sehr verkrampft wirkte. Die Unterschrift hingegen kam locker und flott daher. „Die Textschrift zeigt, wie der Mensch ist“, sagt die Graphologin, „die Unterschrift zeigt eher, wie er gerne sein möchte.“
Von: Robin Szuttor